 Vor 30 Jahren radelten zwei junge Frauen von London nach Harare, um der Welt die Augen für die Not der afrikanischen Tierwelt zu öffnen
Vor 30 Jahren radelten zwei junge Frauen von London nach Harare, um der Welt die Augen für die Not der afrikanischen Tierwelt zu öffnenKlaus Jürgen Schmidt
Norddeutschland (Weltexpresso) – Afrika – Anfang der Neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts:
Die Menschen in den Industrieländern haben es ja geschafft, bei der Jagd nach materiellem Reichtum die Natur ihrer Heimat hoffnungslos und irreparabel aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dennoch meinen ihre Regierungen, den Staaten in der sogenannten Dritten Welt Ratschläge erteilen zu können, die rasch in neue Bevormundung ausgeartet sind: Ohne Konsultation der betroffenen afrikanischen Regierungen haben Europäische Gemeinschaft und die Vereinigten Staaten von Amerika 1989 Afrika einen Elfenbein-Bann auferlegt. Schulterklopfen über alle Fraktionen — von rechts bis links, von schwarz bis grün!
 Aus Kenia übertrug das Fernsehen weltweit die Verbrennung von 12 Tonnen gewilderten Elfenbeins — als ob nicht schon Riesenmengen illegal gehandelter Drogen verbrannt worden wären, ohne dass der Drogenschmuggel auch nur in Ansätzen eingeschränkt worden wäre. Angesichts nicht mehr zu bewältigender Umweltprobleme im eigenen Verantwortungsbereich — Abgas-, Gift- und Nuklear-Problematik — wurde gutes Gewissen auf Kosten afrikanischer Staaten hergestellt, die — wie zum Beispiel Zimbabwe — trotz gerade überwundener Fremdbstimmung und schwieriger Wirtschaftslage das Tier-Erbe mit Sorgfalt pflegen.
Aus Kenia übertrug das Fernsehen weltweit die Verbrennung von 12 Tonnen gewilderten Elfenbeins — als ob nicht schon Riesenmengen illegal gehandelter Drogen verbrannt worden wären, ohne dass der Drogenschmuggel auch nur in Ansätzen eingeschränkt worden wäre. Angesichts nicht mehr zu bewältigender Umweltprobleme im eigenen Verantwortungsbereich — Abgas-, Gift- und Nuklear-Problematik — wurde gutes Gewissen auf Kosten afrikanischer Staaten hergestellt, die — wie zum Beispiel Zimbabwe — trotz gerade überwundener Fremdbstimmung und schwieriger Wirtschaftslage das Tier-Erbe mit Sorgfalt pflegen.In den frühen Sechzigern, als die ersten Staaten Afrikas unabhängig geworden waren, sorgten sich vor allem Weiße — unter engagierter Anteilnahme ihrer Medien — um das nun in ihren Augen zweifellos bedrohte Tiererbe des schwarzen Kontinents: Joey Adamson und Ehemann George kümmerten sich in Kenia um die Löwen, Bernhard Grzimek und Sohn um alle Tiere in der kenianischen Serengeti und Dian Fossey kümmerte sich um die Gorillas in Ruanda — Weiße sahen schwarz für Afrikas Tierwelt!
Für den Beginn einer Rundfunksendung über Zimbabwes Anstrengungen, sein Tiererbe nach eigener Vorstellung zu bewahren, wählten zwei junge zimbabwesche Frauen mit Hintersinn den Titelsong "Born free" aus Joey Adamsons Löwenfilm "Elsa", der in jener Epoche weißer Tierschwärmerei weltweit ein Kassenerfolg war. Sie sind selber weiß und tragen stolz den Titel "Rhino-Girls", auf deutsch "Nashorn-Mädchen" — Charlie Hewat und Julie Edwards. Sie sind 1988 von London bis Harare geradelt, um die Welt auf die gegenwärtige Ausrottung des Rhinozerosses durch Wilderer in Zimbabwe aufmerksam zu machen. Aber, obwohl die beiden jenen weißen Beschützern der afrikanischen Tierwelt die Anerkennung als frühe Warner vor drohender Zerstörung nicht versagen, halten sie mit ihrer Kritik an neuer Bevormundung Afrikas durch Europäer und Nordamerikaner nicht hinter dem Berg:
"Laßt uns hier alleine um unser Tiererbe kümmern!" sagen die beiden. "Und Ihr aus Übersee, mischt euch nicht mehr ein, schließlich habt ihr ja euer eigenes Tiererbe heruntergewirtschaftet!"
Schon eine gute halbe Stunde außerhalb der zimbabweschen Hauptstadt Harare können Touristen ein bißchen von der großen Weite der Wildnis erahnen, können in einem kleinen Nationalpark am Lake McIlwayne erste Bekanntschaft mit Großwild und Raubkatzen machen. Doch die Folgen zunehmender Industrialisierung des Großraums Harare machen sich schon auf diesem Stausee bemerkbar: Riesige Felder von Wasserhyazinthen bedrohen die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt, schon sterben die Fische. Wie groß ist die Gefahr, daß das Land zwischen Sambesi und Limpopo das Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch verliert?
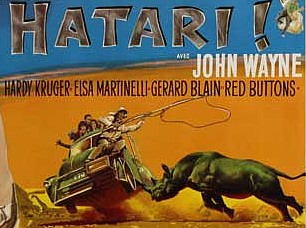 Im Abendlicht am Sambesi: Ein Nashorn trottet durch's trockene Gras hinab zum Wasser. Da fällt ein Schuß. Über 1.000 Kilo Tiergewicht verharrt, vom Einschlag der Kugel gelähmt, sinkt dann langsam zur Seite, die Beine knicken ein — das Nashorn stirbt, bevor es den Feind erkennt, der über den Sambesi kam. Er ist nur an ein paar Kilo dieses mächtigen Tieres interessiert — an seinen beiden Hörnern. Die hackt er ihm in der einbrechenden Dunkelheit ab. Bevor am nächsten Morgen eine Ranger-Patrouille den aufgedunsenen Kadaver findet, sind die Wilderer über die Flußgrenze nach Sambia entschwunden.
Im Abendlicht am Sambesi: Ein Nashorn trottet durch's trockene Gras hinab zum Wasser. Da fällt ein Schuß. Über 1.000 Kilo Tiergewicht verharrt, vom Einschlag der Kugel gelähmt, sinkt dann langsam zur Seite, die Beine knicken ein — das Nashorn stirbt, bevor es den Feind erkennt, der über den Sambesi kam. Er ist nur an ein paar Kilo dieses mächtigen Tieres interessiert — an seinen beiden Hörnern. Die hackt er ihm in der einbrechenden Dunkelheit ab. Bevor am nächsten Morgen eine Ranger-Patrouille den aufgedunsenen Kadaver findet, sind die Wilderer über die Flußgrenze nach Sambia entschwunden.Das ist die Regel, aber es kann auch anders kommen: Am 14. März traf in der Chewore-Safari-Gegend eine Patrouille auf vier schwerbewaffnete Wilderer, es kam zu einem Schußwechsel, den einer der Eindringlinge nicht überlebte. In seinen Taschen fanden die Ranger 8 abgehackte Hörner — wenigstens vier Kadaver hatte die Gruppe irgendwo im Busch zurückgelassen. Einen Monat später kam es zum Kampf mit fünf Wilderern in der Gegend zwischen Mana Pools und Sapi, vier wurden getötet, nur einer entkam. Die Ranger fanden 2 Hörner und stellten 2 moderne AK 47-Gewehre sicher. Seitdem wird hier in den Zeitungen zwei-, dreimal pro Woche über solche Zwischenfälle berichtet — Krieg ist ausgebrochen am Sambesi - und nicht nur dort oben im Norden Zimbabwes.
Schon im Oktober 1988 wurden am Lake Kyle, im Süden, 160 Kilometer entfernt von der nächsten Grenze, die enthornten Kadaver zweier weißer Rhinozerosse gefunden. Nick Greaves von der "Wildlife Society of Zimbabwe" vermutet, daß nun Zimbabwer selbst in das lukrative Schwarzmarktgeschäft mit dem Nashorn eingestiegen sind, das eigentlich kein Horn ist, sondern die feste Masse knorpeligen Haares.
Ein alter Aberglaube bedroht eine der ältesten Tierarten der Erde, die einst auch in Europa bekannt war: Abbildungen sind in altsteinzeitlichen Höhlen z.B. bei Lascaux und Font-de-Gaume in Südfrankreich zu finden. Im nahöstlichen Yemen symbolisiert das Horn, kunstvoll verarbeitet als Dolchgriff, männliche Potenz, im fernöstlichen China wird es — zu Pulver zerrieben — angeblich ebenfalls als Potenzmittel geschätzt. Doch das ist umstritten. Eine Enzyklopädie, publiziert in Zimbabwe, behauptet, nicht als Aphrodisiakum kauften reiche Chinesen und Japaner das Pulver, sondern als fiebersenkendes Mittel. Gesicherte Erkenntnis ist der Preis, den Japaner auf dem Schwarzmarkt zu zahlen bereit sind: In den Siebziger Jahren brachte ein Kilogramm Rhinohorn zwischen 30 und 40 US-Dollar, zehn Jahre später wurden dafür schon bis zu 2.230 US-Dollar ausgegeben. Auf Taiwan werden nach einer Londoner Veröffentlichung für 600 Gramm Hornpulver inzwischen 2.700 US-Dollar bezahlt. Und ein einziges großes Horn, verarbeitet als Dolchgriff für arabische Prinzen, soll schon bis zu 100.000 US-Dollar bringen.
In einer Juli-Nacht des Jahres 1989 rumpelt ein schwerer Laster mit zwei großen Holzkisten in einen abgelegenen Teil des Flughafens von Harare. Er hat vier Stunden Fahrt hinter sich. Die Aktion ist generalstabsmäßig vorbereitet. Über Funk ist sichergestellt, daß eine Frachtmaschine abflugbereit steht. Die Fracht ist kostbar und nervös. Als ich mich den Kisten nähere, sehe ich zwischen Ritzen dunkle Schatten, die sich unruhig bewegen, dann kracht ein Horn gegen die Holzbohlen. Zu dieser Kraft paßt überhaupt nicht das ängstliche Fiepen, das aus den Verschlägen tönt. Die beiden Nashorn-Tiere, männlich und weiblich, sind erst halb ausgewachsen. Sie wurden vor zwei Monaten im Sambesi-Tal mit Pfeilen betäubt und seither in einem Gehege im Manapools-Nationalpark gehalten. Heute nacht sollen sie die lange Flugreise nach Deutschland antreten. Empfänger ist der Frankfurter Zoo. Es ist ein Geschenk Zimbabwes — Nashörner sind unter dem Artenschutzabkommen nicht verkäuflich. Die Landesverschickung ist Teil eines Überlebensprogramms. Vor zwei Tagen sind 10 Nashörner in die USA geflogen worden. Während amerikanische und europäische Tiergehege in ein Zuchtprogramm eingeschaltet sind, ist — ganz nebenbei — sichergestellt, daß Amerikanern und Europäern Tier-Exotik nicht abhanden kommt.
Vor allem wird also Geld gebraucht, dachten sich Charlie Hewat und Julie Edwards, und fanden einen britischen Konzern, "Armstrong World Industries Ltd.", der sich — den Werbe-Effekt einer solchen Idee kühl kalkulierend — bereit erklärte, ihre abenteuerliche Fahrradtour von London nach Harare zu sponsern. Die beiden wurden von Prinz Philipp und Premierministerin Thatcher empfangen — und strampelten los, sie sprachen mit Prinz Bernhard der Niederlande und mit dem Papst — und strampelten weiter, sie gaben Interviews und Vorträge — und strampelten insgesamt 22.000 Kilometer. Und am Ende — nach Durchquerung Europas und Afrikas, als sie unter Anteilnahme der ganzen zimbabweschen Nation über die Brücke an den Victoria-Fällen radelten, glaubten sie der Buchhaltung des britischen Konzerns und meinten, ihr Ziel erreicht zu haben: Umgerechnet fast zwei Millionen Mark aus Spenden für "SAVE THE RHINO" — die Überlebenskampagne für das bedrohte Nashorn. Der Schock kam Anfang März 1989. Der Konzern hatte seine Unkosten abgezogen: runde 950.000 Mark — übrig blieben knappe 300.000 Mark!
Ernüchtert ziehen Charlie und Julie Bilanz: "Gleich nach unserer Radtour haben wir an einer Konferenz mit Frauen über dauerhafte Entwicklungsstrategien teilgenommen," berichten sie, "und besonders spannend war die Erfahrung mit ländlichen, afrikanischen Frauen, die sich konfrontiert sahen mit Experten aus Übersee. Deren Reden waren schwer verständlich, nicht 'mal wir haben alles verstanden," sagt Charlie. Und dann sei eine Afrikanerin vom Lande aufgestanden und habe gesagt: "Viele von euch haben einen akademischen Grad, ein B.A. hinter dem Namen. Das hab' ich nicht, aber hier sind meine beiden Hände, A und B — und mit denen arbeite ich für Afrika."
Charlie Hewat: "Was sie sagen wollte, ist, wir können unseren eigenen Weg in Afrika finden, wir brauchen von euch keine tollen Erläuterungen, wie wir es machen sollten."
"Sie waren absolut phantastisch, die Frauen vom Lande," fügt Julie hinzu. "Sie leben und arbeiten im Dorf. Frauen sind dort verantwortlich für die Ernährung der Familie, sie sind die ganze Zeit zusammen mit den Kindern. Und sie haben schon damit begonnen, ihre eigenen kleinen Projekte aufzubauen — auf unterster Ebene. Und da war eine afrikanische Expertin, die sagte, wir sollten eher auf diese Frauen hören, statt auf Leute da oben — denn sie wissen Bescheid, weil sie ja dauernd dort arbeiten."



