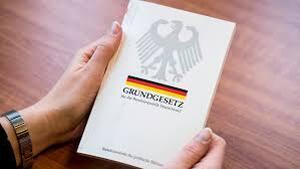
Zum bevorstehenden 75. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai (1/3)
Conrad Taler
Bremen (Weltexpresso) - Die Schöpfer des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland handelten nach ihrem Selbstverständnis im Geiste des „anderen Deutschland“.
Das manifestierte sich im Widerstand gegen das Hitler-Regime. Namhafte Juristen legten Wert auf die Feststellung, dass im Artikel 139 des Grundgesetzes der Rechtssatz der Ächtung des Nazismus in allen seinen Varianten normiert sei. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Frankfurt am Main, Dr. Heinz Düx, erinnerte Anfang der achtziger Jahre daran, dass die Bundesrepublik auch durch Beschlüsse der Vereinten Nationen zu einer antifaschistischen Grundhaltung verpflichtet sei. Er bezog sich dabei auf die UNO-Resolution 200, die von der 35. Vollversammlung der Weltorganisation am 15. Dezember 1980 ohne Gegenstimmen bei 18 Enthaltungen verabschiedet worden ist. Die Entschließung rufe allen ins Bewusstsein, „dass die Vereinten Nationen aus dem Kampf gegen Nazismus, Faschismus, Aggression und ausländische Besetzung hervorgegangen“ seien. Im Vorfeld der Beratungen über das Bekenntnis der UNO zum Antifaschismus wollte die damals oppositionelle CDU von der Bundesregierung in Bonn wissen, ob sie „den auf die Interpretation von Artikel 139 als Fundamentalnorm des gesamten Grundgesetzes gestützten Vorstellungen vom antifaschistischen Charakter des Grundgesetzes“ zustimme. Die Antwort der Regierung bestand aus einem einzigen Wort: Nein. Ungehört verhallte die Forderung des Deutschen Bundesjugendringes, alle rechtlichen Möglichkeiten nach Artikel 139 auszuschöpfen, um faschistische und neonazistische Organisationen aufzulösen und deren Propaganda zu verbieten. Unwidersprochen konnte Heinz Düx 1980 erklären: „In unserem Lande ist eine echte innere Abkehr vom Faschismus trotz entsprechender Inhalte des Grundgesetzes (Art. 139) nie vollzogen worden.“
Begonnen hat die Distanzierung vom Antifaschismus schon viel früher, gleich zu Beginn des Kalten Krieges. Er verhalf den politischen Scharfmachern auf beiden Seiten zu verhängnisvollem Einfluss. Seine Auswirkungen beschrieb Thomas Mann 1950 in einem Vortrag an der Universität Chicago: „Was den Kommunismus betrifft, der mir fremd ist, der aber tiefe Wurzeln hat im russischen Menschentum, so war es erst gestern, dass die westliche Demokratie, um ihr Leben zu wahren, mit dem russischen Kommunismus zusammenstand im Krieg gegen den Nazifaschismus. Heute glaubt man an die Notwendigkeit, die letzten Erinnerungen an dieses Gestern als hochverräterisch auszutreten.“ Den Kalten Krieg nannte Thomas Mann einen chronischen Konflikt, der die Völker niederhalte. Er „hält sie gebunden in Hass und Furcht, zwingt sie, ihre besten Kräfte im Dienst von Hass und Furcht zu vergeuden, hält alles auf, alles zurück, hindert jeden Fortschritt, bringt die Menschen intellektuell herunter, lähmt in großen Nationen das Rechtsgefühl, beraubt sie des Verstandes und macht sie durch Narreteien, zu denen Verfolgungswahn und Verfolgungssucht sie verleiten, voreinander lächerlich. Das Bild des heißen Krieges malt niemand sich aus. Dasjenige des chronischen kalten haben wir vor Augen und sehen, dass er zerstört, was er bewahren will: die Demokratie.“ (Aus: „Über mich selbst“, S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1994, S. 23)
.
Thomas Mann hielt diese Rede wenige Monate nachdem der amerikanische Senator Joe McCarthy mit seiner Behauptung, das Außenministerium in Washington sei voll von Kommunisten, eine bis dahin unvorstellbare Hysterie hervorgerufen hatte. In seinem Buch „McCarthy - oder die Technik des Rufmordes“ (Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh 1959) nennt Richard H. Rovere den „McCarthyismus“ „gleichbedeutend mit grundloser Ehrabschneiderei aus blindwütigem Hass, mit Dreckschleuderei“. In der Bundesrepublik Deutschland fand der amerikanische Kommunistenjäger eifrige Nachahmer. Innerhalb weniger Jahre wurden rund 125.000 Personen mit Ermittlungsverfahren überzogen. Die Zahl der abgeschlossenen politischen Strafverfahren belief sich nach Angaben von Diether Posser („Anwalt im Kalten Krieg“, Bertelsmann, München 1991) bis 1956 bereits auf 3.700. Unter den Betroffenen waren viele Widerstandskämpfer und Verfolgte des Naziregimes aus den Reihen der Kommunistischen Partei, denen Gesinnungstreue abermals zum Verhängnis wurde.
Fortsetzung folgt
Foto:
©Bundesministerium des Innern und für Heimat


