 Ein Nachruf auf Guido Westerwelle – und eine Besprechung seines letzten Buches
Ein Nachruf auf Guido Westerwelle – und eine Besprechung seines letzten Buches
Alexander Martin Pfleger
Frankfurt am Main (Weltexpresso) - Geplant war eine Rezension seines Berichtes aus dem Zwischenreich: „Zwischen zwei Leben. Von Liebe, Tod und Zuversicht“. Nun erreichte uns die Nachricht von seinem Tode. Alles in allem genommen, verschieben sich die Koordinaten nur geringfügig.
Als Liberaler kam für ihn dem Begriff der Freiheit erwartungsgemäß eine besondere Bedeutung bei, doch was genau ist Freiheit – oder, falls man die Frage als zu allgemein gestellt empfinden sollte: Durch welches Synonym läßt sich der Freiheitsbegriff oder lassen sich zumindest einige seiner Teilaspekte konkretisieren, ohne seinen Absolutheitsanspruch zu relativieren oder auch nur den Anschein zu erwecken, als sei dies nötig?
Vergegenwärtigt man sich Guido Westerwelles politische Laufbahn, seine Präsentation durch die Medien und seine persönlichen Reflexionen in seinem Krankenbericht „Zwischen zwei Leben“, so kommt man rasch auf den allzu häufig zur Worthülse gerinnenden Begriff der Selbstbestimmung – Selbstbestimmung nicht allein bezüglich der einem zu Gebote stehenden Möglichkeiten eigenverantwortlichen Handelns, sondern vor allem auch bezüglich zahlreicher Fremdzuschreibungen, die man kaum zu steuern vermag.
Klischees scheinen bei der Formulierung bestimmter Sachverhalte unvermeidbar. Guido Westerwelle war stets darum bemüht, sich durch das zu definieren, was er bewußt angestrebt hatte – als Jurist, als Politiker, als öffentliche Figur. Der häufig als steif wahrgenommene damalige FDP-Generalsekretär begann spätestens ab der Bundestagswahl 1998, mit seiner Ankündigung einer „quirligen und putzmunteren Oppositionspolitik“, den Wandel hin zu jenem leicht von der Zunge gehenden beziehungsweise aus der Feder oder der Tastatur fließenden begrifflichen Phänomen des Spaßpolitikers, das sich bei genauerer Betrachtung nur schwer definieren läßt.
Ausgerechnet anläßlich eines Besuchs in der Harald Schmidt Show brachte Guido Westerwelle sein diesbezügliches Credo auf den Punkt: Weg vom überkommenen politischen Lagerdenken und einer daraus resultierenden, oftmals routinemäßig zur Schau gestellten Verbissenheit, statt dessen Hinwendung zu Argumentation und Substanz. Daß seine damit einhergehenden Bemühungen um eine größere Lockerheit im gegenseitigen Umgang keineswegs der Förderung der Inhaltslosigkeit dienen, sondern vielmehr als Mittel der Entideologisierung fungieren sollten, wurde und wird gerne übersehen – wie auch die Tatsache, daß er sich in seinen Fernsehauftritten stets sachbezogen und inhaltsorientiert äußerte.
Sein Auftritt im Big Brother Bunker am 14. Oktober 2000, wo er immerhin Gelegenheit für einen kurzen, aber gehaltvollen Austausch mit dem österreichischen Kandidaten Walter Unterweger über die liberalen Strömungen der beiden Bundesrepubliken fand, sowie seine Wahlkampftournee 2002 als Kanzlerkandidat mit dem Guidomobil und der 18 auf den Schuhsohlen fuhren den erhofften Erfolg nicht ein, fallen aber im Rückblick nicht besonders unangenehm gegenüber verschiedenen anderen Aktionen der Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien in der Ära Schröder auf, als vielfach der Vorwurf laut wurde, Politik würde weniger im Parlament denn in Polit-Talkshows gemacht, und über den Erfolg entschieden weniger die Inhalte als vielmehr das Vermögen des Vortragenden, sich besser als seine Konkurrenten „zu verkaufen“ – letztlich nur konsequent angesichts der Lesart, der Vorgänger des damals amtierenden Kanzlers sei nicht aufgrund der höheren Kompetenz abgewählt worden, die man seinem Herausforderer zugetraut habe, sondern infolge des diffusen Bedürfnisses nach einem Wechsel – und weil man sein Gesicht nicht mehr habe sehen können.
Der nunmehrige Parteivorsitzende Guido Westerwelle wurde immer mehr zum Gesicht einer neuen, angriffslustigen FDP, die in der Rolle der Oppositionspartei aufzugehen begann. Lange vor dem Selbstmord Jürgen W. Möllemanns, im Prinzip schon am Abend der Bundestagswahl 2002, war der Spaßpolitiker Westerwelle Geschichte geworden. Aber mehr denn je wurde ihm die althergebrachte Seriosität als Charakteristikum des Strebertums zum Vorwurf gemacht. Sein Coming-out als Homosexueller im Sommer 2004, als sich, nachdem es schon jahrelang Gerüchte gegeben hatte, kaum jemand mehr dafür interessierte, werteten viele als verzweifelten Versuch, „menschlicher“ zu wirken – und erneut im Rampenlicht zu stehen. Bespöttelt wurde sein betont staatsmännisches Auftreten bei Stefan Raab vor der Bundestagswahl 2005.
Während Angela Merkels erster schwarz-roter Koalition sollte Westerwelle seine Paraderolle als Oppositionsführer finden – nach dem triumphalen Erfolg der FDP bei der Bundestagswahl 2009 und seinem Einzug ins Außenministerium hinwiederum fanden viele, daß er sich noch nicht mit der Rolle des Regierungsmitglieds angefreundet habe und weiterhin Oppositionspolitiker zu bleiben versuche. Einige mißverständliche Bemerkungen zur Sozialpolitik sowie das Faktum, daß von der von ihm hochgehaltenen Bürgerrechtsschiene der FDP nach dem Wahlerfolg wenig übrig geblieben zu sein schien als einige Vergünstigungen für Hoteliers, konfrontierten ihn, der stets darum bemüht war, das Image der FDP als „Partei der Besserverdienenden“ hin zu einer „Partei der Leistungsträger“ zu korrigieren – von der Putzfrau bis zum Bankdirektor – , erneut mit altbewährten Vorwürfen in Richtung „Klientelpolitik“.
Eine Konstante in Westerwelles öffentlicher Rezeption war seine Unbeliebtheit. Seine kaum bestrittene Kompetenz wurde nur zu gerne als Besserwisserei, Rechthaberei und Überheblichkeit tituliert. Er galt vielen als „nicht authentisch“, als gewiß mit profunden Kenntnissen begabter Analytiker und folglich auch wirkmächtiger Provokateur, ansonsten aber als reiner Taktiker und Machtpolitiker, als lautstarke, selbstverliebte Sprechpuppe und „Leichtmatrose“. Der Sympathiebonus, der bislang jedem deutschen Außenminister von Seiten der Bevölkerung zukam, wurde ihm nicht zuteil. Ganz anders hingegen die Wahrnehmung Karl-Theodor zu Guttenbergs, der einen Sturz ganz anderer Art erleben sollte; einige Formulierungen in Interviews mit Guido Westerwelle zwischen 2009 und 2011, darin er betonte, er, Westerwelle, sei mitnichten in einem Schloß geboren, sondern habe sich alles erkämpfen müssen, deuteten manche als Anspielungen auf eine – im Rückblick wahrscheinlich auch vorwiegend von außen forcierte – Rivalität zwischen den beiden.
Nach seinem Rückzug vom Amt des Parteivorsitzenden und seiner verstärkten Konzentration auf sein Ministeramt wußte er allmählich durch seine politische Arbeit breitere Anerkennung zu erlangen. Hatte man seine Enthaltung beim Libyeneinsatz ursprünglich als Fehlzug gewertet, setzte sich doch langsam die Erkenntnis durch, daß er auf lange Sicht Recht behalten sollte.
Mit der Bundestagswahl 2013 folgte der Sturz der FDP – und offenkundige Häme! Nach Bekanntwerden der zufällig bei ihm diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie (AML) im Sommer 2014 wurde ihm große Anteilnahme zuteil, die sich im Herbst 2015 mit der Veröffentlichung seines Krankenberichts noch einmal steigern sollte.
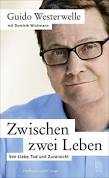 Das gemeinsam mit Dominik Wichmann verfaßte Buch „Zwischen zwei Leben. Von Liebe, Tod und Zuversicht“ hebt als politisches Buch mit persönlicher Note an. Das erste Kapitel trägt den Titel „Mitten in Europa“. Mitten in den Wirren der Ukrainekrise nimmt der noch amtierende Außenminister Guido Westerwelle eine wichtige Vermittlerposition zwischen den Konfliktparteien ein.
Das gemeinsam mit Dominik Wichmann verfaßte Buch „Zwischen zwei Leben. Von Liebe, Tod und Zuversicht“ hebt als politisches Buch mit persönlicher Note an. Das erste Kapitel trägt den Titel „Mitten in Europa“. Mitten in den Wirren der Ukrainekrise nimmt der noch amtierende Außenminister Guido Westerwelle eine wichtige Vermittlerposition zwischen den Konfliktparteien ein.
Das zweite Kapitel hingegen, „Die Auslöschung“, zeigt uns Guido Westerwelle bereits als Patienten, Ende August 2014, als er nach dem endgültigen Abschied aus der aktiven Politik, aber unter Beibehaltung seines politischen Engagements in Form einer Stiftung mit der Diagnose Krebs konfrontiert wurde. Von einem Moment auf den anderen hatte er die, wie es Susan Sontag formulierte, lästige Staatsbürgerschaft im Zwischenreich der Krankheit, der Nachtseite des Lebens, angenommen.
Westerwelle nähert sich der Krankheit im Besonderen, aber auch seinem Leben im Allgemeinen, insbesondere seinem Privatleben, behutsam und – durchaus taktisch an! Er definiert sich als Politiker, der bis zum definitiven Ende seiner Amtszeit seine außenpolitischen Verpflichtungen wahrzunehmen versucht. Entschuldigung? Rechtfertigung? Wohl eher – Erklärung, argumentativ untermauerte Erklärung seiner Tätigkeit, aber auch freimütiges Einräumen von Fehlern („spätrömische Dekadenz“).
Dabei entschied er sich für eine nicht-lineare Erzählweise. In einzelnen Streiflichtern wird sein Werdegang beleuchtet. Ihm ging es darum, allein durch seine Aktionen, genauer gesagt, seine Leistungen beurteilt zu werden. Seine Homosexualität blieb lange Zeit eine reine Privatangelegenheit – lediglich bei der Musterung sollte er sie anführen. Ansonsten war man zu taktischem Verhalten genötigt – die Affäre Kießling führte nur allzu deutlich vor Augen, wie es um die Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland in manchen Bereichen tatsächlich noch lange Zeit bestellt war. Auch nach der öffentlichen Bekanntmachung seiner Beziehung zu dem Event-Manager Michael Mronz sollte seine sexuelle Orientierung nicht im Mittelpunkt des Interesses stehen.
„Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt´s einen, der die Sache regelt!“ Das gelang Westerwelle lange Zeit im Politischen wie im Privaten – nun aber, als Krebspatient, wurde ihm klar, daß die Krankheit das Ruder übernommen hatte, und daß es allein Ärzten und Therapeuten gegeben war, ihn wieder in einen Zustand zu versetzen, da er sich wieder ans Steuer zu setzen wagen dürfe. Guido Westerwelle versuchte, auch angesichts der Krankheit und der von ihr ausgelösten Ohnmachtsgefühle, nach Möglichkeit aktiv zu bleiben – auf dem Gebiet der Reflexion und deren Verschriftlichung. Souveränität bewies er – die Anlehnung an den antiliberalen Staatsrechtslehrer Carl Schmitt sei gestattet – , indem er auch über den Ausnahmezustand zu entscheiden suchte, also die Zeit der Krankheit. Indes – banale Erwägung am Rande: Ist das Leben nicht per se ein einziger Ausnahmezustand? Was ist der Normalzustand?
Aufrichtige Anteilnahme und aufrichtig empfundenes Mitleid sind etwas anderes als herablassendes Bemitleiden – das hat Guido Westerwelle nicht verdient, und darauf zielt auch dieses Buch nicht ab. Leider – so unser subjektiver Eindruck – scheint es bisweilen so, als spielte bei der großen Aufmerksamkeit, die es erfuhr, vielleicht doch ein wenig die gönnerhafte Neigung eine Rolle, demjenigen sich zu öffnen, der nun durch Krankheit geläutert sei und die Probleme anderer Menschen nun mit neuen Augen sähe.
Der Grund hierfür dürfte struktureller Art sein – die neugewonnene Sensibilisierung für das Leiden anderer aus seiner bisherigen politischen Positionierung zu erklären, welche diese freilich zuvor nicht so offensichtlich zum Vorschein habe treten lassen, und nicht als alleiniges Resultat der eigenen Leidenserfahrungen zu präsentieren, birgt gestalterische Risiken. Aber wo ein Risiko, da ist auch eine Chance. Die Antwort dürfte, wie so häufig, in der Mitte liegen – und warum sollte man nicht an der Gestaltung dieses Dilemmas scheitern dürfen? Dies wäre dann aber auch die einzige, letztlich auch nur angedeutete, Schwäche dieses sehr klaren und deutlichen, gleichwohl verhaltenen, zurückgenommenen, im Auftritt leisen, aber alles andere als leisetreterischen Buches.
In dessen Mitte, als achtes Kapitel, steht, in bewußter Anspielung auf Kafka, „Die Verwandlung“ Guido Westerwelles vom Gesunden zum Kranken und deren öffentliche Bekanntmachung am 20. 6. 2014. Das fünfzehnte und abschließende Kapitel, „In der Mitte der Nacht beginnt ein neuer Tag“, zeigt uns einen mittlerweile wieder halbwegs zu Kräften gekommenen, aber, wie wir nun wissen, keineswegs genesenen Guido Westerwelle.
Jörg Thomann schrieb in der FAS vom 8. 11. 2015: „Als einer, der künftig weniger polarisieren und mit Worten nicht mehr verletzen möchte, dürfte sich Westerwelle im Politbetrieb mit seinen Rivalitäten und Ränkespielen nicht mehr zu Hause fühlen. Insofern markiert „Zwischen zwei Leben“ den endgültigen Abschied des Politikers Guido Westerwelle. Der Mensch Guido Westerwelle jedoch, in welcher Rolle auch immer, dürfte der Gesellschaft noch viel zu geben haben.“ Mit diesem Buch hat er uns viel gegeben – mehr war ihm leider nicht mehr vergönnt. So mancher Leser wird seine Eindrücke in den Worten Gregor Gysis aus dessen Nachruf auf SPIEGEL ONLINE vom 19. 3. 2016 bestätigt sehen: „Jeder weiß, daß Guido Westerwelle gut reden konnte, kaum jemand weiß, daß er auch gut zuhören konnte.“ Denn nur wer auch gut zuhören konnte, konnte ein solches Buch schreiben.
Die Koordinaten verschoben sich nur geringfügig: Der Neuanfang sollte sich als Schlußwort erweisen, aber die Substanz bleibt bestehen.
Guido Westerwelle erduldete die „Pfeil´ und Schleudern des wütenden Geschicks“ nicht, sondern suchte sie, „sich wappnend gegen eine See von Plagen, durch Tätigkeit“ zu enden. Er gelangte – „immer strebend sich“ bemühend – hinauf und bewährte sich: „Höchst königlich“? Die intendierte Anerkennung hat er sich verdient – allerdings war er ja kein Monarchist, sondern freier Demokrat, und Schlösser waren nie so sein Ding.
Fest steht, daß er ein politisches und auch ein literarisches Erbe hinterlassen hat, das es zu bewahren gilt.
Als „Vordenker für die internationale Verständigung der Länder“, der „sich um die Europäische Integration und das Ansehen Deutschlands in Europa und der Welt verdient gemacht“ habe, wie es der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier in seiner Stellungnahme vom 18. 3. 2016 formulierte, als Streiter für Weltoffenheit und Toleranz und gegen nationalistische Engstirnigkeit fehlt er uns allen mehr denn je!
Info:
Guido Westerwelle (mit Dominik Wichmann): Zwischen zwei Leben. Von Liebe, Tod und Zuversicht
Hoffmann und Campe, Hamburg 2015
240 Seiten, EUR 20.00 (DE), EUR 20.60 (AT), sfr 26.90 (freier Preis)
ISBN: 978-3-455-50390-6
EAN: 9783455503906

